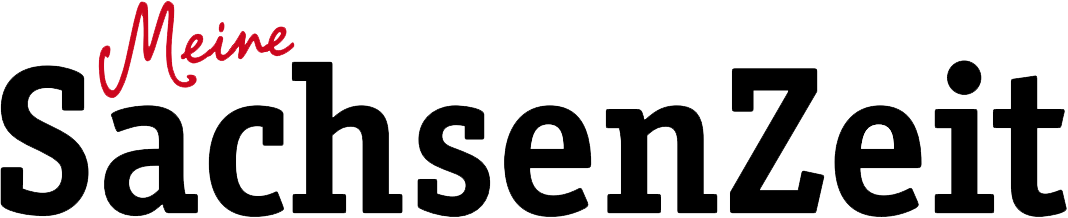Die Kunstsammlungen präsentieren in der Kulturhauptstadt 2025 eine Sonderausstellung mit Werken von Edvard Munch (1863–1944), bei der das Gefühl der Angst im Fokus steht. Die Kunstsammlungen Chemnitz verfügen über einen bedeutenden Bestand an Grafiken und einem Gemälde von Edvard Munch, der für die Ausstellung durch Leihgaben von internationalen und nationalen Institutionen und Privatsammlungen erweitert wird. Parallel werden zeitgenössische Positionen, etwa von Marina Abramović, Monica Bonvicini, Irene Bösch, Michael Morgner, Osmar Osten, Neo Rauch, Paula Rego und anderen, im Dialog mit Munchs Werken zu sehen sein.
Die Kunstsammlungen präsentieren in der Kulturhauptstadt 2025 eine Sonderausstellung mit Werken von Edvard Munch (1863–1944), bei der das Gefühl der Angst im Fokus steht. Die Kunstsammlungen Chemnitz verfügen über einen bedeutenden Bestand an Grafiken und einem Gemälde von Edvard Munch, der für die Ausstellung durch Leihgaben von internationalen und nationalen Institutionen und Privatsammlungen erweitert wird. Parallel werden zeitgenössische Positionen, etwa von Marina Abramović, Monica Bonvicini, Irene Bösch, Michael Morgner, Osmar Osten, Neo Rauch, Paula Rego und anderen, im Dialog mit Munchs Werken zu sehen sein.
Der norwegische Maler Edvard Munch ist ein Existentialist. Durch seine gefühlsdurchdrungene Malerei wurde er zum Seismografen einer ganzen Zeit und goss gleichzeitig das Fundament der Kunst neu. Munchs Werke sind zu Ikonen tiefer menschlicher Seelenzustände geworden, wie am Beispiel „Schrei“ zu sehen ist. Der Künstler setzte eindrucksvoll die überwältigende Erfahrung von Angst in ein Bild, in dem er die Natur als auch die Figur zittern lässt. In der Ausstellung wird die Lithografie aus dem Jahr 1895 aber auch Andy Warhols „The Scream (After Munch)“ von 1984, gezeigt. „C the Unseen“ als Leitgedanke der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz macht sich unter anderem zur Aufgabe, die Geschichte des Ortes zu thematisieren. Edvard Munch reiste 1905 auf Einladung der kunstsinnigen Fabrikantenfamilie Herbert und Johanna Esche erstmals nach Chemnitz, um Familienporträts zu malen, von denen das Porträt „Herbert Esche“ aber auch der „Blick aufs Chemnitztal“ als Leihgabe in der Ausstellung gezeigt werden. Zu diesen besonderen Geschichten des Ortes gehört ebenso das Werk „Zwei Menschen. Die Einsamen“, 1906-1908. Munchs Gemälde wurde 1928 für die Städtische Kunstsammlung Chemnitz angekauft, 1929 war es das Highlight in der großen Munch Retrospektive in der Stadt. Im Nationalsozialismus wurde das Werk 1937 verkauft, nun, nach fast 90 Jahren, wird es als Leihgabe aus den USA erneut in Chemnitz zu sehen sein.
Mit Munchs kraftvollem Werk wird die Frage aufgeworfen: Ist Einsamkeit eines der Hauptthemen unserer Zeit? Hierzu wurde der Pavillon der Angst als mobiler Begegnungsraum initiiert, um das Gespräch mit dem Einzelnen und der Stadtgesellschaft zu suchen.